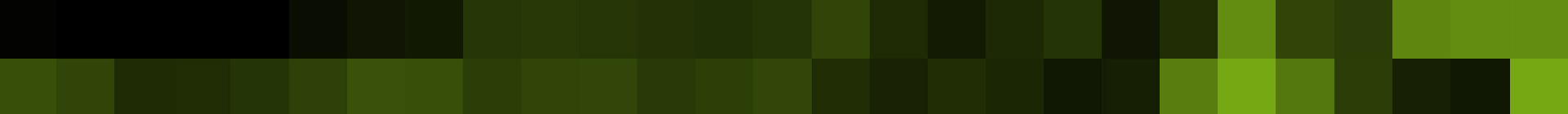Wissenschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Wirkung/Transfer
Wir forschen und lehren zu den Chancen und Risiken von Wissenschaftskommunikation in polarisierten gesellschaftlichen Kontroversen, z.B. zu den Debatten um die Regulierung von Genom Editierung, den Klimawandel, die Digitalisierung u.a.m.
Uns interessiert zum Beispiel, wie die Medien über diese Themen berichten, welche Akteure sich in diesen Debatten mit welchen Argumenten zu Wort melden, wie die Medieninhalte auf das Medienpublikum oder auf involvierte Akteure wirken (z. B. Wissenschaftler oder Umweltschützer) und wie sie politische oder gesellschaftliche Prozesse beeinflussen.
Vorlesung Medienwirkungen und Öffentlichkeit
5000106 - Medienwirkungen und Öffentlichkeit (Vorlesung)
Inhalt der Vorlesung:
Die meisten Demokratietheorien gehen davon aus, dass Bürgerinnen und Bürger gut informierte Wahlentscheidungen treffen können. Dies setzt voraus, dass relevante Informationen öffentlich verfügbar sind, dass richtige von falschen Informationen unterschieden werden können und dass Bürgerinnen und Bürger die Kompetenz und das Interesse haben, sich mit relevanten Sachthemen auseinanderzusetzen. Die Leitfrage dieser Vorlesung ist, inwieweit diese Voraussetzungen in digitalisierten Mediensystemen, die sich durch das Aufkommen generativer Künstlicher Intelligenz in einem erneuten Transformationsprozess befinden, erfüllt sind.
Wir schauen uns dazu normative Vorstellungen von Öffentlichkeit und die Dynamiken öffentlicher Meinungsbildung an, die Rolle des Journalismus und der Medien, die Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürger, sich mit Sachthemen auseinanderzusetzen sowie die Art und Weise, wie Medienberichterstattung Teilnehmende am öffentlichen Diskurs beeinflussen kann.
Ablauf
In der ersten Sitzung erhalten Sie eine Einführung in die Thematik und einen Überblick über den Semesterplan. Sie erhalten auch eine Literaturliste mit Pflichttexten, anhand derer die Inhalte der Vorlesung eigenständig nachbereitet und ergänzt werden sollen. Wir empfehlen Ihnen, die Texte gründlich nach jeder Sitzung (und nicht erst vor der Klausur zu lesen) und sich zu jedem Text Notizen zu machen. Die Pflichttexte sind klausurrelevant.
Lernziele
Am Ende der Vorlesung …
Kennen Sie bedeutsame normative Konzeptionen von Öffentlichkeit;
Können Sie grundlegende Prozesse öffentlicher Meinungsbildung theoretisch fassen;
Kennen Sie grundlegenden Chancen und Probleme der Digitalisierung öffentlicher Kommunikation;
Haben Sie einen Überblick über die derzeit diskutierten Chancen und Risiken Generativer Künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Kommunikation;
Kennen sie grundlegende Theorien journalistischer Nachrichtenauswahl;
Kennen Sie grundlegende medienpsychologische und mediensoziologische Ansätze, die erklären, wie Menschen Informationen auswählen, verarbeiten und wie diese Informationen auf sie wirken.
Dozent: Lukas Schmidt
Proseminar Medienwirkungen und Öffentlichkeit, Kurs A und B
Proseminar Aktuelle Fragen der Wissenschaftskommunikation, Kurs B
Das Seminar beschäftigt sich mit Framing und Agenda-Setting in moderner Wissenschaftskommunikation. Neben inhaltlichen Grundlagen werden Methoden der empirischen Kommunikationsforschung behandelt. Die Studierenden lernen Framing und Agenda-Setting als klassische Konzepte der Kommunikationswissenschaft kennen, lesen dazugehörige Schlüsselstudien und setzen sich kritisch mit den verwendeten Methoden auseinander. In semesterbegleitenden Gruppenarbeiten werden fiktive Forschungsansätze entwickelt, mit denen sich die klassischen Ansätze der Kommunikationsforschung auf moderne Anwendungsfälle der Wissenschaftskommunikation übertragen lassen. Das Seminar schließt mit einer Hausarbeit als Prüfungsleistung zum Ende des Semesters.
Dozentin: Maria Röhreich
Informationen zu Abschlussarbeiten
Als Studierende am Department für Wissenschaftskommunikation, können Sie bei uns am Lehrstuhl Wissenschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Wirkung/Transfer eine Abschlussarbeit verfassen. Abschlussarbeiten können sich damit beschäftigen, wie in Umwelt- und Nachhaltigkeitsdebatten kommuniziert wird, welchen Informationen sich Akteure zuwenden oder wie Kommunikation auf gesellschaftliche Akteure wirkt. Grundsätzlich gibt es zwei Typen von Abschlussarbeiten:
1. Literaturarbeit: Sie erheben den Sachstand zu einer Forschungsfrage auf der Grundlage der verfügbaren Literatur. Sie stellen eine gesellschaftlich oder praktisch relevante Forschungsfrage, identifizieren auf der Grundlage wissenschaftlicher Literaturrecherchen die relevante Forschungsliteratur und arbeiten diese durch, um die relevanten Befunde zur Beantwortung Ihrer Frage sowie zur Identifizierung von Wissenslücken zu kondensieren.
2. Forschungsarbeit: Sie beantworten eine klar umrissene Forschungsfrage auf der Grundlage einer empirischen Erhebung. Sie stellen eine Forschungsfrage, leiten auf der Grundlage der existierenden Forschungsliteratur Ihre Forschungshypothesen und prüfen sie auf der Grundlage einer zielgerichteten, systematischen und nachvollziehbaren Datenerhebung.
Wir erwarten von Ihnen außerdem, dass Sie die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens beherrschen. Sie sollten bspw. sicher zitieren (APA7) und Ihre Abgaben müssen den entsprechenden Formalitäten genügen.
Interessenten wenden sich bitte an einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vereinbaren einen Sprechstundentermin.